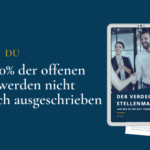Karriere-Shift unter neuen Arbeitsmarktbedingungen: Deutsche Hürden und internationale Best Practices
Ob als Sales-Profi, Teamlead oder frischgebackener MBA-Holder: Immer mehr spielen mit dem Gedanken, die eigene Branche zu verlassen, um Karriere, Purpose und Gehalt in Einklang zu bringen. Doch aus der täglichen Erfahrung heraus sieht Rainmaker Society Gründer und CEO, Dirk Schuran, dass das nicht immer so leicht möglich ist. Warum ist der Wechsel in Deutschland (im Gegensatz zum angelsächsischen Raum) oft so holprig – und wie können die Stolpersteine umgangen werden?
Arbeitsmarktkultur & Risikoaversion
Deutschland tickt sicherheitsorientiert: Es zählen lineare Lebensläufe, lange Firmenzugehörigkeit und die Erwartung, dass Expertise unbedingt branchenspezifisch sein muss. Es verwundert nicht, dass Quereinsteiger schneller als „unsicher“ abgestempelt werden.
Im angelsächsischen Raum zählt dagegen das Können und nicht, wo etwas gelernt wurde. Transferable Skills wie Leadership, Deal-Making oder Data Literacy stehen dort klar im Fokus.
„Der deutsche Arbeitsmarkt ist nicht so flexibilisiert wie der englische Arbeitsmarkt. Meines Erachtens hat hier insbesondere Maggie Thatcher in den 80er Jahren einen großen Anteil. Sie hat viele Strukturen verändert, sei es durch die Zähmung der Gewerkschaften, durch Privatisierungen, aber auch durch massive Deregulierung.“ Dirk Schuran
Mobilität: Bleiben oder springen?
In Deutschland beträgt die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit knapp elf Jahre – ein deutliches Signal für die hohe Bedeutung von Stabilität und Loyalität. Viele Fach- und Führungskräfte denken erst dann über einen Branchenwechsel nach, wenn Rationalisierungen anstehen, sich eine Aufstiegschance im eigenen Unternehmen verschließt oder die persönliche Neuausrichtung erforderlich wird.
Anders sieht es in den USA und Großbritannien aus: Dort gilt ein häufiger Rollen- und Branchenwechsel als strategischer Karrierebaustein. Mehrere Stationen innerhalb eines Jahrzehnts werden als Ausdruck von Lernbereitschaft und Anpassungsfähigkeit gewertet, nicht als mangelnde Ausdauer.
Wer in Deutschland erfolgreich die Branche wechseln möchte, sollte die Entscheidung sorgfältig vorbereiten. Gezielte Weiterbildungen, projektbasierte Erfolge und ein schlüssiges Kompetenzprofil sind der Schlüssel, um den Mehrwert der wechselbereiten Haltung sichtbar zu machen. Je klarer dabei auf Impact und Transferable Skills verwiesen wird, desto eher werden Unternehmen überzeugt, die bisher Kontinuität höher gewichtet haben als Dynamik.
Wo der Branchenwechsel klappt – und wo er scheitert
Bevor Zeit, Netzwerk und Weiterbildungen in Richtung einer neuen Industrie gelenkt werden, lohnt sich ein nüchterner Blick auf deren Aufnahmefähigkeit für Quereinsteiger. Einige Branchen schätzen externe Perspektiven und honorieren übertragbare Kompetenzen, während andere auf nachweislich tiefe Fach- und Regulierungskenntnisse bestehen. Die folgende Übersicht zeigt, wo die Türen weit offen stehen – und wo mit längeren Anlaufzeiten zu rechnen ist.
| Wechsel-Hotspots | Warum es funktioniert |
| IT & Tech | Akuter Fachkräftemangel, offene Kultur, „Skill > Titel“-Mindset |
| Marketing & Kommunikation | Übertragbare Kernkompetenzen (Storytelling, Data-Insights), jedoch Vorsicht: B2B- vs. B2C-Silos |
| Logistik & E-Commerce | Hoher Bedarf an operativer Exzellenz, schneller Proof of Impact möglich |
| Wechsel-Bremsen | Warum es hakt |
| Pharma & Medizin | Strikt regulierte Prozesse, jahrelange Fachausbildung Pflicht |
| Banken & Finance | Vertrauensargument: langjährige Branchenerfahrung als Sicherheitsanker |
| Maschinenbau & Industrie | Traditionell, technikorientiert, oft skeptisch gegenüber „Outsidern“ |
Alter & Wechselbereitschaft
Aktuelle Erhebungen belegen, dass die Wechselbereitschaft in Deutschland ihren Höhepunkt zwischen 30 und 39 Jahren erreicht: Im StepStone-Jobwechsel-Kompass 2023 gaben 57 % der Befragten in dieser Altersgruppe an, innerhalb der nächsten zwölf Monate einen Branchen- oder Arbeitgeberwechsel zu planen. Eine IAB-Betriebspanel-Auswertung 2024 bestätigt den Trend: Nach Vollendung des 45. Lebensjahres sinkt der Anteil wechselwilliger Beschäftigter auf unter ein Drittel, wobei der Rückgang in stark regulierten oder traditionell geprägten Branchen – etwa Maschinenbau, Chemie und öffentliche Verwaltung – besonders ausgeprägt ist.
Empirische Daten bestätigen, dass ein Branchenwechsel auch jenseits der 50 in Großbritannien und den USA jedoch etabliert ist. So zeigt die Annual Survey 2023 des Institute of Interim Management (IIM), dass knapp zwei Drittel der britischen Interim-Manager mindestens 50 Jahre alt sind. Das CIPD «Labour Market Outlook» Q4/2023 meldet zugleich, dass bereits jedes fünfte britische Unternehmen projekt- oder interimsbasierte Verträge nutzt, um Senior-Expertise kurzfristig einzubinden.
Für die USA kommt die AARP-Studie «The Value of Experience» (2023) zu einem ähnlichen Ergebnis: Fach- und Führungskräfte über 50 sind dort überdurchschnittlich oft als Consultants oder in temporären Führungsrollen tätig. Gemeinsam belegen diese Quellen, dass projektbasierte Beschäftigungsmodelle und Interim-Leadership in beiden Ländern institutionell verankert sind – und damit den Branchenwechsel im fortgeschrittenen Alter deutlich erleichtern.
Recruiting-Perspektive: Wie schaut HR auf „Industry Switchers“
Deutsche Unternehmen entscheiden oft nach der Frage: „Kann die Person morgen anfangen und sofort Umsatz liefern?“ Ohne Branchenerfahrung wird das eng. Angelsächsische Firmen ticken anders: Sie budgetieren längere Ramp-Up-Phasen und setzen systematisch auf die bereits erwähnten Transferable Skills.
„Es ist kein Geheimnis, dass ich glaube, dass wir auch eine Politikerin wie Maggie Thatcher gebrauchen könnten, um den deutschen Arbeitsmarkt deutlich flexibler zu gestalten …“ Dirk Schuran
Weiterbildung als Schlüssel zum schnellen Branchenwechsel
Ein Wechsel vom Automotive-Konzern in ein SaaS-Start-up oder von der Finanzbranche in die Healthcare-Tech-Sphäre gelingt in der Regel nur mit gezielter Weiterbildung. Sie schafft nicht nur die fachliche Grundlage, sondern liefert zugleich den sichtbaren Nachweis, dass Veränderungsprozesse konsequent umgesetzt und neue Technologien rasch adaptiert werden.
In den USA genügt dafür häufig bereits eine Kurzausbildung wie ein dreimonatiges Google-Certificate. Der dortige Arbeitsmarkt honoriert Micro-Credentials, weil Geschwindigkeit und nachweisbare Kompetenz entscheidende Selektionskriterien sind. In Deutschland dominieren hingegen klassische Formate wie IHK- oder HWK-Lehrgänge. Diese besitzen zwar hohe Reputation, sind jedoch selten agil: Starre Curricula und lange Präsenzphasen erschweren eine zeitnahe berufliche Neuorientierung.

Hybride Lernstrategie
Formelle Programme lassen sich idealerweise durch internationale Online-Kurse, Bootcamps oder Nano-Degrees ergänzen und verbinden so die in Deutschland geschätzte formale Zertifizierung mit der im angelsächsischen Raum geforderten Lernagilität. Kurse mit unmittelbarem Projekt-Output – etwa Case Studies, Capstone-Projekte oder Hackathons – schaffen Referenzen, die im Bewerbungsprozess stärker überzeugen als reine Multiple-Choice-Zertifikate.
Insbesondere ehemalige Konzernmitarbeitende, die bislang in stark regulierten Strukturen tätig waren, sichern sich über diesen Weg belastbare Eintrittsreferenzen für neue Branchen. Allerdings muss man auch zu deutlichen Einschnitten bereit sein: Oftmals ist zumindest kurzfristig das alte Konzerngehalt nicht wieder realisierbar.
Weiterbildungsmaßnahmen entfalten die größte Wirkung, wenn sie schnell, sichtbar und marktrelevant sind. Daher empfiehlt sich der Fokus auf kompakte, international anschlussfähige Programme anstelle langwieriger, überholter Lehrgänge.
Der deutsche Markt, aber auch “der Deutsche” liebt Stabilität – noch. Doch Fachkräftemangel, New Work und globale Konkurrenz zwingen selbst tradierte Arbeitgeber umzudenken. Wer schon heute mutig den Branchenwechsel plant, sichert sich einen echten First-Mover-Advantage, allerdings kann auch jeder Einzelne hier mehr Offenheit anderen Berufswegen gegenüber zeigen …
Kontaktier uns für eine individuelle Beratung und starte deinen strategischen Branchenwechsel noch dieses Quartal.
Über Dirk Schuran
Dirk Schuran ist Ex-CSO von Comatch, mehrfacher Gründer und Business Angel. Er hat einige Stationen im Lebenslauf – von der politischen Arbeit im Kreisvorstand einer politischen Nachwuchsorganisation über die Konzernerfahrung in der Medienbranche bis zum Early Stage-StartUp und der Begleitung bis zum Exit. Als Vater, Marathonläufer und Netzwerker bringt er Perspektive, Klarheit und Energie in die moderne Karriereberatung. Seine Mission: Talente zu stärken, nicht zu verbiegen.